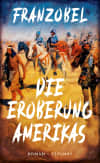Nach dem Bestseller „Das Floß der Medusa“ begibt sich Franzobel in seinem neuen Roman auf die Spuren eines wilden Eroberers der USA im Jahr 1538.
Ferdinand Desoto hatte Pizarro nach Peru begleitet, dem Inkakönig Schach und Spanisch beigebracht, dessen Schwester geschwängert und mit dem Sklavenhandel ein Vermögen gemacht. Er war bereits berühmt, als er 1538 eine große Expedition nach Florida startete, die eine einzige Spur der Verwüstung durch den Süden Amerikas zog. Knapp 500 Jahre später klagt ein New Yorker Anwalt im Namen aller indigenen Stämme auf Rückgabe der gesamten USA an die Ureinwohner.
Franzobels neuer Roman ist ein Feuerwerk des Einfallsreichtums und ein Gleichnis für die von Gier und Egoismus gesteuerte Gesellschaft, die von eitlen und unfähigen Führern in den Untergang gelenkt wird.
Ferdinand Desoto hatte Pizarro nach Peru begleitet, dem Inkakönig Schach und Spanisch beigebracht, dessen Schwester geschwängert und mit dem Sklavenhandel ein Vermögen gemacht. Er war bereits berühmt, als er 1538 eine große Expedition nach Florida startete, die eine einzige Spur der Verwüstung durch den Süden Amerikas zog. Knapp 500 Jahre später klagt ein New Yorker Anwalt im Namen aller indigenen Stämme auf Rückgabe der gesamten USA an die Ureinwohner.
Franzobels neuer Roman ist ein Feuerwerk des Einfallsreichtums und ein Gleichnis für die von Gier und Egoismus gesteuerte Gesellschaft, die von eitlen und unfähigen Führern in den Untergang gelenkt wird.
Details zum Buch
Erscheinungsdatum: 2021-01-25T00:00:00Z
544 Seiten
Zsolnay
Hardcover
ISBN 978-3-552-07227-5
Deutschland: 26,00 €
Österreich: 26,80 €
Presse
„Ein über 500-seitiges Panorama mit kauzigen Figuren, eingefangen in einer bilderreichen, vor satirischen Bonmots strotzenden Sprache. (…) Ein großes Vergnügen!!“ Gerard Otremba, Rolling Stone, Mai 2021
"Mit derben Witzen und aufklärerischem Anspruch erzählt Franzobel von der „Eroberung Amerikas“. ... Aus seinen Recherchen und den historischen Fakten ist ein bunter, vielstimmiger Roman voller skurriler Figuren entstanden." Steffen Herrmann, Frankfurter Rundschau, 30.03.21
"Ein Stoff, der ganz im Sinne Franzobels als umtriebiger, fabulierlustiger Liebhaber für Grotesken und schrägen Humor ist. ... Mal muss der Leser schallend lachen, mal bleibt einem das Lachen vor Entsetzen im Halse stecken.“ Lerke von Saalfeld. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.03.21
"Der Name Franzobel steht für gepflegte Groteske, für Absurdität und schwarzen Humor. Bei dieser Literatur darf oft gelacht werden, mit Vorliebe böse und abgründig. ... Franzobel überzeugt einmal mehr durch Einfallsreichtum und stilistische Virtuosität." Christian Schacherreiter, Kurier, 14.03.21
"Skurril und mit sehr viel Humor erzählt. … Franzobel bringt einen ungeheuer leichten Ton hinein, ohne das alles zu banalisieren. ... Das ist wirklich ganz ganz große Kunst." Irene Binal, Ö1 ex libris, 14.02.21
„Ein spannender und effektvoller, aber auch zutiefst verstörender Roman“, Günter Kaindlstorfer, WDR5 Bücher, 05.02.21
"Ein Roman, der den Opfern der Geschichte Gerechtigkeit widerfahren lässt, und das ganz ohne pädagogischen Missionierungseifer.“ Katja Gasser, ORF Zeit im Bild, 27.01.21
"Mit viel Einfallsreichtum spielt der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller in seinem neuen Roman ein Szenario durch, das an den Machtstrukturen der heutigen Gesellschaft rüttelt." Martina Kothe, NDR Kultur, 25.01.21
"Dass Franzobel Poetik mit Faktischem verknüpft, dass er, wenngleich dem Surrealismus durchaus nahe, von Realem berichtet, macht den besonderen Reiz seines jüngsten Romans aus. 'Die Eroberung Amerikas' ist, bei aller grotesken Farbigkeit, ein politischer Roman, der besser nicht in unsere Gegenwart passen könnte." Thomas Rothschild, Die Presse, 23.01.21
"Mit Verve, Fabulierlust und Mitteln der Volksoper entwirft Franzobel farbenprächtige Bilder und ein Panoptikum skurriler Figuren. So ist 'Die Eroberung Amerikas' Erkenntnis- und Lesevergnügen zugleich, mit einer Utopie am Ende – und preisverdächtig." Cornelia Zetzsche, BR2 KulturWelt, 22.01.21
"Mit derben Witzen und aufklärerischem Anspruch erzählt Franzobel von der „Eroberung Amerikas“. ... Aus seinen Recherchen und den historischen Fakten ist ein bunter, vielstimmiger Roman voller skurriler Figuren entstanden." Steffen Herrmann, Frankfurter Rundschau, 30.03.21
"Ein Stoff, der ganz im Sinne Franzobels als umtriebiger, fabulierlustiger Liebhaber für Grotesken und schrägen Humor ist. ... Mal muss der Leser schallend lachen, mal bleibt einem das Lachen vor Entsetzen im Halse stecken.“ Lerke von Saalfeld. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.03.21
"Der Name Franzobel steht für gepflegte Groteske, für Absurdität und schwarzen Humor. Bei dieser Literatur darf oft gelacht werden, mit Vorliebe böse und abgründig. ... Franzobel überzeugt einmal mehr durch Einfallsreichtum und stilistische Virtuosität." Christian Schacherreiter, Kurier, 14.03.21
"Skurril und mit sehr viel Humor erzählt. … Franzobel bringt einen ungeheuer leichten Ton hinein, ohne das alles zu banalisieren. ... Das ist wirklich ganz ganz große Kunst." Irene Binal, Ö1 ex libris, 14.02.21
„Ein spannender und effektvoller, aber auch zutiefst verstörender Roman“, Günter Kaindlstorfer, WDR5 Bücher, 05.02.21
"Ein Roman, der den Opfern der Geschichte Gerechtigkeit widerfahren lässt, und das ganz ohne pädagogischen Missionierungseifer.“ Katja Gasser, ORF Zeit im Bild, 27.01.21
"Mit viel Einfallsreichtum spielt der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller in seinem neuen Roman ein Szenario durch, das an den Machtstrukturen der heutigen Gesellschaft rüttelt." Martina Kothe, NDR Kultur, 25.01.21
"Dass Franzobel Poetik mit Faktischem verknüpft, dass er, wenngleich dem Surrealismus durchaus nahe, von Realem berichtet, macht den besonderen Reiz seines jüngsten Romans aus. 'Die Eroberung Amerikas' ist, bei aller grotesken Farbigkeit, ein politischer Roman, der besser nicht in unsere Gegenwart passen könnte." Thomas Rothschild, Die Presse, 23.01.21
"Mit Verve, Fabulierlust und Mitteln der Volksoper entwirft Franzobel farbenprächtige Bilder und ein Panoptikum skurriler Figuren. So ist 'Die Eroberung Amerikas' Erkenntnis- und Lesevergnügen zugleich, mit einer Utopie am Ende – und preisverdächtig." Cornelia Zetzsche, BR2 KulturWelt, 22.01.21
Downloads
Hier finden Sie Cover in unterschiedlichen Formaten sowie Presseinformationen und weiterführendes Material zu unseren Titeln für Presse und Buchhandlungen.Zum Download-Portal
Autor:in
Franzobel
Franzobel, geboren 1967 in Vöcklabruck, erhielt u. a. den Ingeborg-Bachmann-Preis (1995), den Arthur-Schnitzler-Preis (2002), den Nicolas-Born-Preis (2017) und den Bayerischer Buchpreis (2017). Bei Zsolnay erschienen zuletzt der Krimi Rechtswalzer (2019) sowie die in zahlreiche Sprachen übersetzten historischen Romane Das Floß der Medusa (2017), Die Eroberung Amerikas (2021) und Einsteins Hirn (2023).
Weitere Bücher von Franzobel
Weitere Empfehlungen für Sie
Stöbern

Newsletter
Unser Newsletter informiert Sie nicht nur über aktuelle Bücher, Neuigkeiten aus dem Verlag und Termine, sondern liefert auch Interviews, Notizen und Hintergrundtexte von und mit unseren Autor:innen.
Hinweise zum Datenschutz, Widerruf sowie Erfolgsmessung und Protokollierung erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.